Gastbeitrag von Marcus Klippgen, Hamburg
Fast jeder, der sich heute mit der Anschaffung eines Neuwagens befasst, ist verunsichert: Kann man noch einen Diesel kaufen, wenn ihm in Europas Städten nun immer mehr Einfahrverbote drohen? Oder werden wenigstens Diesel nach Euro 6d davon ausgenommen sein? Obwohl deren Abgasreinigungssysteme dafür sorgen, dass alle EU-Grenzwerte in praxi sicher eingehalten werden, scheint langfristig noch nicht einmal der Euro 6d-Diesel vor dem Zugriff ökobeflissener Abmahnvereine sicher. Zu erfolgreich geriert sich einstweilen das Geschäftsmodell der „Deutschen Umwelthilfe“…
Ist also ein Benziner zukunftssicherer?
Trotz Turbo- oder Kompressor-Aufladung ist ein Benzinmotor für schwere SUV, Vans und reine Langstreckenfahrzeuge denkbar ungeeignet: Vergleichsweise schlappes Drehmoment bzw. nervig hohe Drehzahl, unsäglich hoher Verbrauch und damit CO2-Ausstoß. Aber gut – demnächst werden vermehrt bezahlbare Plug-in-Hybride erscheinen, deren 48V-Maschinen den Drehmomentverlauf des Benziners „boosten“ und über kurze Strecken sogar einen rein elektrischen Fahrbetrieb ermöglichen werden. Damit wird es den Herstellern zumindest „erleichtert“, den ab 2020 obligatorischen EU-Flottengrenzwert von 95 g CO2 pro Kilometer einzuhalten. Ob allerdings jedermann die Möglichkeit hat, seinen Plug-in-Hybrid nachts in die Dose zu stecken, ist eine andere Frage.
Die EU den CO2-Grenzwert bis 2030 um weitere 35 Prozent senken
Gleichwohl schwebt über Verbrennungsmotoren insgesamt das Damoklesschwert der Verbannung. Denn bis 2030 will die EU den CO2-Grenzwert bis 2030 um weitere 35 Prozent – also auf 62 g/km – senken. Das entspricht einem Benzinverbrauch von 2,7 l/100 km, beim Diesel sogar nur 2,3 l/100 km. Mit einem nach heutigen Maßstäben vollwertigen Auto ist das nicht zu schaffen, trotz Hybridisierung. Und es gibt Regierungen in Europa, die Neuwagen mit Verbrennungsmotoren bis spätestens 2040 gänzlich verbieten wollen.
Wer aber nun, so wie mancher laustarker Grüner, das Heil der Menschheit allein im „Battery Elektric Vehicle“ – im Folgenden kurz „BEV“ – sieht, der sollte wissen: Die Herstellung von 1 kWh „Lithium-Ionen-Akku“ verursacht rd. 180 kg CO2. Das heißt, dass ein großes BEV allein schon aufgrund seines 90 kWh-Akkus mit einen CO2-Rücksack von 17 t antritt, bevor es auch nur einen einzigen Meter aus eigner Kraft gefahren ist! Bis selbige 17 Tonnen CO2 bei einem heutigen, verbrennungsmotorischen Mittelklassewagen zusammen kommen, muss dieser (bei unterstelltem CO2-Ausstoß von 170 g/km) rund 100.000 Kilometer weit fahren. Erst danach kann sich die Ökobilanz eines batteriebetriebenen Privatwagens zugunsten verringerter Erderwärmung wenden. Solche hohen Kilometerleistungen erreichen Stadtbusse, Ver- und Entsorgungs- sowie Lieferfahrzeuge schneller. Sie sind auch weniger von der Lade- und Reichweitenproblematik
betroffen, so sie nur im Regionalradius und abends zurück in ihre (Lade-)Depots verkehren. Hier ist reiner Elektroantrieb also durchaus vernünftig, zumal völlige Eimissionsfreiheit in Innenstädten natürlich ein Vorteil ist. Aber selbst dann kommen – beim heutigen Strommix – immer noch rd. 60% des Ladestroms aus fossilen Quellen, sprich: aus Kohle und Gas. Nur fällt das CO2 dann eben nicht am Auspuff des Autos, sondern am Schornstein des Kraftwerks an. Und spätestens angesichts von rd. 30% (Lade-)Verlust auf dem Weg vom Kraftwerk bis in die Batterie kann ein effizienter Verbrenner sogar CO2-schonender als ein BEV unterwegs sein.
VW-Chef Diess formulierte es neulich überspitzt, aber trefflich: „Die Wahrheit ist: Sie stellen nicht auf Elektro um, sondern auf Kohlebetrieb“. Im Übrigen sind verbrauchte Akkus zwar grundsätzlich recyclingfähig, doch bei der Rückgewinnung ihrer Stoffe fällt erneut CO2 in der oben geschilderten Größenordnung an.
Dass sich China dennoch an die Spitze der BEV-Bewegung gesetzt hat, ist aus dortiger Sicht völlig rational
China verfügt über die Rohstoffe, die man zur Batterieherstellung braucht. China droht in seinen Megastädten zu ersticken, wenn es nicht auf „Zero Emission“ setzt. Chinas Zentralregierung kann Stromtrassen, Ladeinfrastrukturen und BEV-Quoten „anordnen“. Und China sieht im BEV die historische Chance, in den weltweiten Automobilmarkt einzusteigen. Alle diese vier Gesichtspunkte gelten weder für Europa, noch für die USA. Will sagen: Der Westen hat andere Ausgangsbedingungen. Dass westliche Autohersteller trotzdem BEV herausbringen, begründet sich also in erster Linie aus der Opportunität des mittlerweile weltgrößten Automarktes China. Und in Europa aus den bereits erwähnten scharfen Emissionsvorgaben der EU.
Mithin ist es weniger Überzeugung, als vielmehr die politische Gemengelage, welche die Hersteller zur
Entwicklung von BEV veranlasst
So werden Daimler und die Volkswagen-Gruppe ab 2020 Autos auf rein BEV-spezifischen Plattformen anbieten, die mit Grundpreisen ab etwa 30T€ „bezahlbarer“ sein sollen, als die die einstweiligen Luxus-BEV vom Schlage Jaguar i-Pace, Audi e-tron oder Mercedes EQC, geschweige denn eines über 100 T€ teuren (wenngleich atemberaubenden) Porsche Taycan.
BMW setzt dagegen auf eine fertigungsuniverselle Plattform, die sowohl rein batterieelektrische, als auch verbrennungsmotorische bzw. hybride Antriebe zulässt. Denn die Stückzahlprognosen sind beim BEV noch sehr unsicher. Mit dessen Komfort, Spurtstärke und rekuperierender Bremswirkung beim Gaswegnehmen freundet sich zwar jeder schnell an. Ob dies aber auch für den höheren Preis, die eingeschränkte Reichweite und die langen Ladezeiten gilt, ist fraglich. Zumal man an einer normalen Haushaltsteckdose mindestens eine ganze Nacht braucht, um am nächsten Morgen wieder „vollgetankt“ losfahren zu können. Wenn man denn überhaupt über einen Stellplatz mit Stromanschluss verfügt! Schneller geht es mit einer „Wallbox“, aber die braucht einen 380 V-Drehstromanschluss. Schneller geht es auch an öffentlichen 50 kW-Gleichstromladesäulen, nur: Wo steht die nächste freie Ladesäule und wie ist das mit dem Bezahlsystem und der Ladestecker-Norm? Am schnellsten lädt man an 150 kW-Ladern, aber diese setzen ein entsprechend proprietäres BEV-Konzept sowie eine spezielle Stromnetzversorgung voraus (liebe Taycanfreunde).
Das zweite Problem ist die begrenzte Reichweite
Zwar beträgt unsere alltägliche Fahrstrecke vielfach unter 80 Kilometer. Doch wer sein Auto nicht nur im Nahbereich, sondern auch für längere Distanzen nutzen will, bekommt ein Problem. Denn die nach Norm vielfach propagierten 500 Kilometer Reichweite größerer BEV können sich in praxi glatt auf 250 km halbieren – nicht nur abhängig von der Fahrweise, sondern auch davon, ob zusätzliche Verbraucher wie Licht, Wischer und vor allen Heizung und Gebläse an der Batterie saugen. Während bei einem Verbrennungsmotor (leider) mindestens 60% des Kraftstoffenergiegehaltes als Abwärme „frei Haus“ anfallen, braucht ein BEV eine E-Heizung! Und wie viel Strom diese zieht, weiß jeder, der einmal mit E-Heizlüftern zu tun hatte. So kann sich die Praxisreichweite beispielsweise eines Smart EQ im Winter auf 70-80 km reduzieren. Aber gut, der Akku dieses Stadtflohs hat auch nur eine Kapazität von 17,6 kWh.
Damit sind wir bei der Achillesferse: Dem Akku
Er ist die Schlüsselkomponente jedes BEV. Er – und weniger der Elektromotor – entscheidet nicht nur über die Fahrleistungen, sondern auch über die Ladezeiten und Reichweite. Damit nicht genug: Bei heutigen Gestehungskosten von rund 200 € pro kWh Akkukapazität hat er einen wesentlichen Anteil an den Herstellkosten. Ein 50 kWh Lithium-Ionen-Akku, wie man ihn für ein Auto in Golfgröße braucht, repräsentiert also einen Wert von 10 T€. Dafür entfällt beim BEV der mechanisch und steuerungstechnisch aufwändige Verbrennungsmotor nebst Getriebe und Abgasreinigung, indem an seine Stelle eine vergleichsweise simple (und weitgehend wartungsfreie) E-Maschine nebst Leistungselektronik tritt. Das heißt, dass sich der Wertschöpfungsanteil dramatisch in Richtung „Antriebsbatterie“ verschiebt – der Anteil des Traktionsakkus kann glatt 40% betragen! Nur Tesla soll dank Eigenfertigung und Gemeinschaftsentwicklung mit Panasonic mittlerweile die Kostenmarke von 100 € pro kWh erreicht haben. Von diesem Wert können andere Hersteller bislang nur träumen.
Zwar beherrscht man hierzulande das Konfektionieren der Batteriezellen, um daraus Akkus zu bauen, die der Leistungselektronik (sog. „Inverter“) des Antriebsystems eine Spannung von meist 400 Volt zur Verfügung stellen (Porsche sogar 800 V). Dazu gehört auch ein Heiz- und Kühlsystem („Thermomanagement“), welches der Akku braucht, um sich möglichst im Temperaturbereich 20-40 °C „wohlfühlen“ zu können. Bei Schnellladen mit hoher Stromzufuhr oder umgekehrt bei hoher Stromentnahme bei starkem Beschleunigen kann die Batterie knallheiß werden und schlimmstenfalls sogar explodieren. Dies verhindert das Akku-Kühlsystem, zumal ein Herunterregeln der Leistung bitte nur ultima ratio sein sollte (liebe Teslafreunde). Die eigentliche Schlüsselkomponente des Akkus ist indessen die Zelle: Ihr Aufbau, ihre Materialien, ihre Zellchemie entscheiden über die Performance des Akkus – und damit über die des ganzen BEV.
Dennoch gibt es in Europa bislang keine Zellenfertigung
Die Hersteller sitzen vielmehr in Südkorea, Japan und China. Daher treten neben große Zulieferer wie Bosch, Conti oder
ZF nun zunehmend Namen wie LG, Samsung, Panasonic oder CATL. Von ihnen hängt (außer Tesla) jeder europäische oder amerikanische Automobilhersteller ab, der seinen Antrieb ganz oder teilweise elektrifizieren will. Zwar plant der chinesische Hersteller CATL ab 2020 eine Fertigung bei Erfurt, aber deren Kapazität von 14 GWh p. a. dürfte nur für etwa 250.000 BEV im Jahr reichen. Einstweilen sind die weltweiten Zellfertigungskapazitäten denkbar angespannt – da sprechen die ernüchternd langen Lieferfristen heutiger BEV Bände. Daher steht, entgegen den Hoffnungen mancher BEV-Startups, kaum zu erwarten, dass die Preise der Zellen kurzfristig sinken werden.
Warum also um alles in Welt produziert man in Europa keine eigenen Zellen?
Hinderungsgrund für hiesige Hersteller wären weniger jene 8-10 Mrd. €, die man investieren müsste, um mit Zellfertigungsstandorten in Europa, USA und Asien global wettbewerbsfähig zu sein. Diese Investition könnten „die Deutschen“ stemmen – allemal in denkbaren Konsortien aus Autoherstellern und großen Zulieferern.
Der Grund für die bisherige Zurückhaltung hiesiger Player ist vielmehr Folgender: Trotz weltweit intensiver Forschung, Initiative des Deutschen Wirtschaftsministers, EU-Fördermitteln und Versuchen mit alternativen Batteriekonzepten wie „Lithium Schwefel“ oder „Lithium-Luft“ ist noch immer nicht absehbar, welche Zelltechnologie die zukunftssicherste ist. Das betrifft weniger die Form der Zellen (eckige lassen sich kompakter anordnen, runde besser kühlen), sondern primär deren inneren Aufbau. Hier fragt sich, ob die heute etablierte „Lithium-Ionen“-Technik tatsächlich das Pferd ist, auf das man langfristig setzen kann: Wie groß ist das weitere Entwicklungspotential von „Li-Ion“, um – bei gegebenen Kosten sowie Mindestanforderungen an Be- und Entladeverhalten, chemische Verschleißfestigkeit und thermische Beherrschbarkeit – die volumen- bzw. gewichtspezifische Energiedichte des Akkus noch zu steigern? Ließe sich die Energiedichte der Zellen gegenüber heute verdoppeln, würden Praxisreichweiten von 6-700 Kilometern bei großen BEV realistisch. Dies versprechen z. B. „Feststoffelektrolyte“, die man demnächst in China erstmals in industriellem Maßstab fertigen will. Doch einstweilen scheint noch nicht sicher, ob die industrielle Fertigung dieser hochenergetischen Akkus wirtschaftlich darstellbar ist und ob sie im Feldbetrieb stabil funktionieren.
Auch stellen sich Fragen zur Abhängigkeit von Rohstofflieferanten sowie zur Nachhaltigkeit
Wie viel Kobalt lässt sich etwa bei „Li-Ion“ noch einsparen – also jener Rohstoff, der fast nur in der Republik Kongo vorkommt und dort – jedenfalls teilweise – unter unmenschlichen Bedingungen aus der Erde geholt wird?
Wie umweltschädigend ist das großflächige Herausspülen von Lithium aus der Erde in Chile, wo es große Li-Vorkommen gibt? Und wer beherrscht diese Rohstofflieferketten?
Hintergründe hierzu zeigt die sehenswerte 3Sat-Dokumentation “DieSchattenseiten der E-Mobilität“
Welche Zelltechnologie auch immer sich durchsetzen wird: A la longue wird sie zwangsläufig zu einem austauschbaren Massenprodukt werden, dessen Wettbewerbsfähigkeit allein von Rohstoff- und Herstellkosten abhängt. Es ist zumindest diskutierbar, ob derartige „Commodity“ zu den Strukturen hiesiger Hersteller passt. Das ist der zweite Grund für deren Zurückhaltung.
Sind „Batterien“ tatsächlich der Energiespeicher des 21. Jahrhunderts?
Drittens fragt sich ganz grundsätzlich, ob „Batterien“ tatsächlich der Energiespeicher des 21. Jahrhunderts sein werden. Denn wir haben gesehen, welche ökologischen Probleme und Abhängigkeiten mit großen Traktionsakkus einhergehen. Fachleute sind sich daher einig, dass Wasserstoff (H2) der nachhaltigere Energieträger wäre. Das normalerweise gasförmige H2 kommt in der Natur nicht vor, lässt sich aber durch Elektrolyse von Wasser (H2O) abspalten. In 700 bar-Drucktanks aus recyclingfähigem CFK komprimiert lässt es sich im Fahrzeug transportieren. Der „Tankvorgang“ dauert keine drei Minuten und der Energiegehalt reicht für mindestens 700 Kilometer. Im Auto reagiert H2 in einer Brennstoffzelle (Fuel Cell) mit dem Sauerstoff (O) der Umgebungsluft zu reinem Wasser, wobei Strom entsteht. Dieser gelangt in eine – wohlgemerkt: kleine – Pufferbatterie, die den Antriebsmotor speist. Das System arbeitet absolut umweltneutral, wenn man den Elektrolysestrom zu 100% aus regenerativen Energien bezieht – Wind, Sonne oder theoretisch Meeresenergie.
Zwar ist richtig, dass Elektrolyse und Kompression von H2 ungefähr viermal mehr Strom verbrauchen, als sich hinterher aus der Brennstoffzelle zurückgewinnen lässt. Aber die Natur stellt genügend regenerative Energie zur Verfügung. So könnte die Menschheit ihren Energiebedarf vollständig aus regenerativen Energien beziehen, wenn sich diese nur speichern ließen! Doch Wind bläst bekanntlich nicht konstant, Sonne scheint nicht immer und Meere bewegen sich eben zu Gezeiten. Regenerative Energien sind also „volatil“. Daher braucht man einen Zwischenspeicher. Sofern man hierfür keine größenwahnsinnigen „Batteriehäuser“ erreichten will, kann dieser Speicher nur Wasserstoff sein. Er lässt sich übrigens auch durch Pipelines schicken, ggf. auch in seiner Vorstufe Methanol. Und die Aufrüstung einer Tankstelle auf Wasserstoff kostet überschaubare 200 T€. Mithin wäre die Distribution kein größeres Problem. Wenn in Europa nur der politische Wille dazu vorhanden wäre – so wie in Japan und Südkorea.
Nebenbei wäre Wasserstoff auch die Voraussetzung für die Herstellung synthetischer „E Fuels“, mit denen der Weltbestand verbrennungsmotorischer Fahrzeuge von heute auf morgen konventionell betankt, aber damit CO2-neutral betrieben werden könnte. Einziger Haken ist, dass die „Stacks“ der Brennstoffzelle noch sehr teuer sind, weshalb ein „F-CELL“-Auto bislang nicht unter 65 T€ darstellbar ist. Hieran arbeitet man zwar, insbesondere bei Toyota und Hyundai.
Aber das ist nun ein Wettlauf mit der Zeit
Denn sollte die Batterieentwicklung innerhalb der nächsten fünf Jahre so entscheidende Fortschritte machen, dass ein BEV zum Preis eines konventionellen Golf erhältlich und mit halbwegs auskömmlicher Reichweite gesegnet ist, hätten Wasserstoff und Brennstoffzelle das Rennen verloren. Vorerst jedenfalls. Denn wir sollten die Hoffnung für unseren Planeten nicht aufgeben.
Über den Autor:
Marcus Klippgen war in der Bosch-Gruppe tätig, einem weltweit führenden Zulieferer der Automobilindustrie.
„Technik fürs Leben“ versteht man bei Bosch umfassend. Hier agierte der Marketingmann Klippgen ein Vierteljahrhundert als kommunikatives Bindeglied zwischen Technik und Markt. Klippgen lebt heute in Hamburg und arbeitet als freier Autor und Moderator im Automobilsektor.
www.buero-klippgen.de <http://www.buero-klippgen.de>

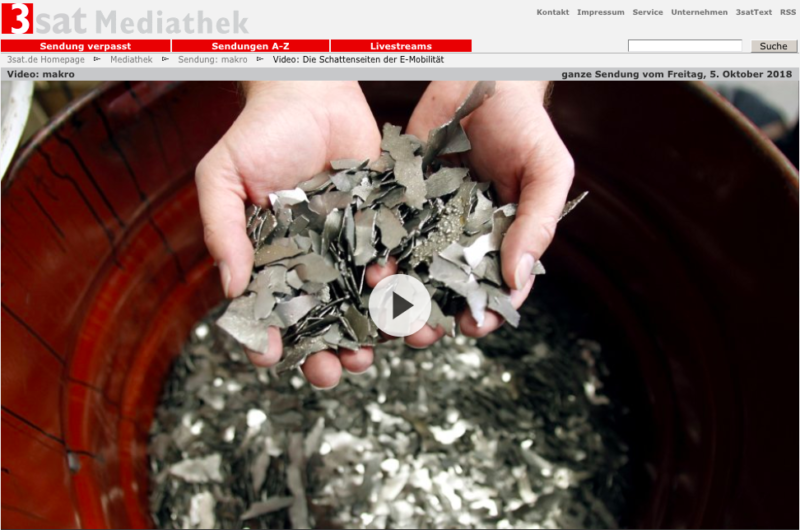





Anscheinend hat Bosch noch nicht das der Drops gelutscht ist.
Da braucht man auch nicht zum 100. Mal falsche Ergebnisse wiederholen.
Das Benzin kommt aus dem Brunnen vor der Tankstelle, und ein Tesla wird mit einem sparsamen Verbrenner verglichen.
Nur zur Info.
Das Öl wird verbrannt, der Akku bleibt. Er hält ja nicht nur 100.000km sondern im Prinzip ewig!
Verehrter Oliver,
ich spreche nicht für Bosch, sondern unabhängig für mich allein. Daran ändert nichts, dass Bosch früher
einmal mein Arbeitgeber war.
Abgesehen davon mutet Ihre Behauptung allerdings kühn an, der weltgrößte Zulieferer habe noch nicht
begriffen, dass „der Drops gelutscht ist“. Bosch liefert seit Anbeginn E-Maschinen und Inverter nicht nur
für elektrifizierte Pkw, sondern auch für elektrifizierte Transporter. Für Langstrecken-LKW arbeitet Bosch
bereits an Wasserstoffantrieben. Bei E-Bikes und E-Scootern ist Bosch sogar Weltmarktführer mit kompletten
Antrieben, weil diese Kleinfahrzeuge lediglich kleine Akkus brauchen. Nur in Sachen „Großbatteriefertigung“
hält sich Bosch – so wie bislang auch alle anderen deutschen Automobilplayer – zurück, weil die einstweilige Batterietechnologie für Pkw und Nfz füglich zu hinterfragen ist – nicht nur wirtschaftlich, sondere insbesondere
auch in ökologischer Hinsicht.
Was an meinen Ergebnissen im Einzelnen falsch sein soll, enthüllt Ihr Kommentar nicht.
Dass der weltweite Rohölverbrauch kritisch ist, leugne ich an keiner Stelle. Daher weise ich auf den ökologisch nachhaltigeren Weg hin: Wasserstoff und Brennstoffzelle. Dagegen können „Batterien“ nur eine Übergangstechnologie
sein – selbst wenn sich ihre Energiedichte und Ökobilanz noch weiter verbessern sollte. Die Frage ist nicht „ob“,
sondern „wann“ Wasserstoff und Brennstoffzelle für die Massenmotorisierung kommen werden. Spätestens Mitte
des 21. Jahrhunderts dürfte es soweit sein. Dem widersprechen noch nicht einmal die klugen Chinesen.
Nein, der Akku hält mitnichten „im Prinzip ewig“: Zwar kann man nicht Handyakkus vergleichen, die meist
schon nach 1-2 Jahren schwächeln, weil ihre Zellen nicht so wie im Auto „gemanagt“ werden. Doch Erfahrungen
im Feld zeigen, dass der sog. „Hub“ (also die nutzbare Kapazität) auch bei automotiven Traktionssakkus im
Laufe der Zeit abnimmt. Bei pfleglichem Umgang (wenig Extrembeschleunigungen und Schnellladungen, gutes Thermomanagement) dürfte der Hub nach 100.000 km zwar noch 90% aufweisen. Aber je nach Beanspruchung
des Akkus nimmt der Hub weiter ab, bis er spätestens nach 10 Jahren nur noch 60-70% aufweist. Dann ist der
Akku im Auto unbrauchbar und muss recycelt werden. Man kann verbrauchte Traktionsakkus in stationären „Batteriehäusern“ weiterverwenden (z. B. den Akku des BMW i3). Aber diese Restverwertung wäre spätestens
dann keine Lösung mehr, wenn Millionen von Alt-Akkus auf die Menschheit zurollen sollten.
Mein Vergleich eines BEV mit 90 kWh-Akku („CO2-Rucksack“) mit einem sparsamen Verbrenner ist sehr wohl
zulässig: Für den Verbrenner zog ich als Vergleichswert 170 g CO2/km an. Der größenmäßig mit einem Tesla S vergleichbare Mercedes S 350 CDI stößt im Norm-Mix 177 g/km aus, der etwas kleinere Mercedes E 300 CDI
sogar nur 144 g/km. Ähnliche Werte gelten auch für andere Fabrikate.
Ich leugne nicht, dass der Tesla wesentlich besser beschleunigt. Wenn man diese Fahrleistungen allerdings
ausnutzt, kommt man mit dem Tesla keine 200 Kilometer weit. Und bei derartiger Fahrweise wird der Akku des
Tesla so heiß, dass dessen Kühlung nicht mehr ausreicht. Dann regelt der Tesla S/X schlagartig die Leistung
herunter. Viel Spaß, wenn das beim Überholen auf der Landstraße passiert…
Gruß
Marcus Klippgen
Aktueller Nachtrag: Die Republik Kongo verdreifacht die Lizenzgebühren auf Kobaltabbau, was die Beschaffungssituation für Li-Ion-Akkus zwar nicht erschwert, aber verteuert. Näheres unter https://www.electrive.net/2018/12/04/kongo-verdreifacht-lizenzgebuehren-fuer-den-kobaltabbau/
Aktueller Nachtrag: Die EU will den CO2-Flottengrenzwert für Hersteller bis 2030 nunmehr sogar um 37,5% senken, also auf etwas über 59 g/km. Der Spielraum für Verbrennungsmotoren wird also noch enger als in meinem Gastbeitrag erwähnt.
Aber noch eine Leseempfehlung zum Thema Batterie: Im “ams” Heft 02/2019 vom 03.01.2019 auf S.52 ff. informiert Heinrich Lingner über den Stand der Batterieentwicklung und erläutert auch allgemeinverständlich batterietechnische Zusammenhänge. Lingner ist ein herausragender Motorjournalist, weil er nicht nur die Vergangenheit und Gegenwart der Automobiltät versteht, sondern auch deren Zukunft. Sehr lesenswert!